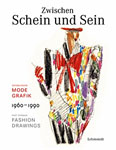Die Nadeln des Aufstands. Eine Kulturgeschichte des Strickens.
Die Nadeln des Aufstands. Eine Kulturgeschichte des Strickens.
Schiná, Katerina: Die Nadeln des Aufstands. Eine Kulturgeschichte des Strickens. Aus dem Griechi-schen übersetzt und herausgegeben von Doris Wille. Bad Herrenalb, Edition Converso, 2021. 216 S., 21 farb. Abb. ISBN 978-3-9822252-5-8
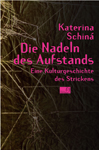
Crafty bedeutet übersetzt listig oder gerissen. Sein zugehöriges Substantiv craft wiederum kann mit Geschicklichkeit bzw. Handwerk übersetzt werden. Und genau diese Geschicklichkeit bzw. dieses Können ihres Handwerks, verbunden mit der nötigen „Gerissenheit“ in der Themenzusammenstellung muss man der Autorin Katerina Schiná neidlos zugestehen.
In ihrem 2014 in Athen zuerst auf Griechisch erschienenen und seit 2021 in deutscher Übersetzung vorliegenden Buch Die Nadeln des Aufstands. Eine Kulturgeschichte des Strickens gelingt ihr eine kurzweilige und zugleich sehr informative, wissenschaftlich fundierte Darlegung des Strickhandwerkes in unterschiedlichsten Facetten. Die Autorin „verstrickt“ dabei das wollene Handwerk mit Literatur, Musik, Darstellender Kunst, Mathematik, Philosophie, Psychoanalyse und Gesellschaftspolitik, eingebettet in biografische Anekdoten. Es gelingt ihr eine kritische Auseinandersetzung sowohl mit einem rückwärtsgewandten Bild des Strickens als auch dessen esoterisch-ideologischer Überfrachtung. Männliche wie weibliche Stereotype werden aufgebrochen – beispielsweise mit den gestrickten Superhero Costumes des Künstlers Mark Newport oder mit einer rebellischen, Todeslisten strickenden Madame Defarge aus Charles Dickens‘ Eine Geschichte aus zwei Städten. Weiterlesen... Download
Text: © Monika Keller
Monika Keller für netzwerk mode textil e. V. (online: 30.01.2022)
Nouveautés – Kunstschule und Spitzenindustrie Plauen
Thomas A. Geisler; Kerstin Stöver; Ute Thomas: Nouveautés – Kunstschule und Spitzenindustrie Plauen. Herausgeber: Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Dresden 2020. ISBN 978-3-95498-578-4
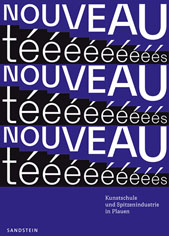
„Nouveautés“ – als „Neuheiten“ bezeichnet der historisch bewanderte Textilkenner vor allem Spitzen, Bänder, Borten und vieles mehr. Der Begriff geht auf die ersten „Magasins de Nouveautés“ im Paris des 18. Jahrhunderts zurück, die Vorläufer der modernen Warenhäuser, die ihre Produkte erstmals mit festen Preisen versahen und hinter gläsernen Schaufenstern öffentlich ausstellten und feilboten.
„Nouveautés – Kunstschule und Spitzenindustrie in Plauen“ nennt sich passenderweise eine beeindruckende Publikation, die eine gleichnamige Ausstellung begleitet, in der es sich um die stilprägenden „Neuheiten“ der Stickerei und Spitzenindustrie des Vogtlandes dreht. Im Corona-Jahr 2021 werden nicht viele Interessierte den Weg in das nahe Dresden gelegene Schloss Pillnitz, den Ausstellungsort, gefunden haben, was überaus schade ist. Nur bis Ende Oktober 2021 waren die vielen filigranen Textilschönheiten dort zu sehen, von Ätz- über Bobinet- und Margareten- bis hin zu Zellenspitze und vielem mehr. Weiterlesen... Download
Text: © Gerlind Hector
Gerlind Hector für netzwerk mode textil e.V. (online seit 15.01.2022)
About Time: Fashion and Duration
Bolton, Andrew u.a.: About Time: Fashion and Duration. Ausst. Kat. The Metropolitan Museum of Art, New York. New Haven u. London, 2020. 400 S., 240 s/w Abb. ISBN 978-1588396884.

Im Jahr 2020 feierte das Metropolitan Museum of Art (MET) sein hundertfünfzigjähriges Bestehen. Zum Jubiläum richtete das Kostüm-Institut – eine selbständige Einheit im MET – eine Ausstellung über Vergänglichkeit und Dauer, Wiederentdeckungen und Neu-Interpretationen in der Damenmode aus. Der Katalog zur Ausstellung verknüpft tiefschürfende theoretische Überlegungen mit der visuellen Anschaulichkeit von Modefotografie und unterlegt alles mit viel Poesie. Die zentrale Aussage lautet: Modeentwicklung verläuft nicht linear. Vergangene Stile und Formen verschwinden nicht, sondern tauchen abgewandelt wieder auf. Wiederholung ist eine Konstante der Modegeschichte. Weiterlesen... Download
Text: © Rose Wagner
Rose Wagner für netzwerk mode textil e.V. (online seit 27.05.2021)
Geldkatzenwäsche. Kommentierte Neuherausgabe der Schriften Ingrid Köllers zur Didaktik textiler Sachkultur
Derwanz, Heike / Mühr, Patricia (Hg.): Geldkatzenwäsche. Kommentierte Neuherausgabe der Schriften Ingrid Köllers zur Didaktik textiler Sachkultur. Band 2 der Reihe „Vermittlung der Studien zur Materiellen Kultur“ hrsg. von Heike Derwanz, Elisabeth Eichelberger, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 2020, 211 S., s/w und zahlr. farb. Abb., ISBN 978-3-943652-41-3 [Print], ISBN 978-3-943652-48-6 [PDF] >

Die sehr informative, kommentierte Neuherausgabe der Schriften Ingrid Köllers (1935-2002) ist das Ergebnis eines 2-jährigen Projektes an der Universität Oldenburg und wird durch zahlreiche Abbildungen illustriert. Ziel ist es, die Texte Ingrid Köllers in einem Band wieder verfügbar zu machen und in einen aktualisierten Forschungskontext zu setzen. Köller begründete als Professorin von 1985 bis 2000 an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg das Fach Textilwissenschaften und baute das Institut auf. Die Autor*innen begeben sich auf eine Spurensuche nach der Person Köllers und veranschaulichen in der Beschreibung materieller Zeugnisse Köllers pragmatisches Denken und Wirken. So wird die von der leidenschaftlichen Sammlerin begründete Sammlung an Textilien, die diese als „Materialisierung einer Systematik des Textilen“ versteht, in dem Beitrag von Carolin Krämer als „Lehr- und Forschungsressource“ dargestellt. Bastian Guong beschreibt, wie sich diese Sammlung im Laufe der Zeit verändert und erweitert hat. Weiterlesen... Download
Text: © Dorit Köhler
Dorit Köhler für netzwerk mode textil e. V. (online seit 13.04.2021)
Zwischen Schein und Sein. Ostdeutsche Modegrafik 1960-1990
Lindner, Ute (Hg.): Zwischen Schein und Sein. Ostdeutsche Modegrafik 1960-1990. 239 S., 200 farb. Abb. Leipzig, Lehmstedt Verlag, 2020. ISBN 978-3957971135
Mit dem Aufkommen der Modefotografie ‒ insbesondere der Farbfotografie ‒ verlor die Modegrafik zunehmend an Bedeutung. Seit den sechziger Jahren verschwand sie weitgehend aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit. Das war im Osten nicht anders als im Westen. Hinter den Kulissen von Modezeitungen und Produktionsstätten spielte sie in Form von Entwurfszeichnungen und Trendskizzen allerdings weiterhin eine Rolle, wenn auch keine tragende mehr.
Der auf ostdeutsche Themen spezialisierte Lehmstedt Verlag legt jetzt einen opulenten Bildband mit 200 handgezeichneten Entwurfsskizzen und Modeillustrationen aus der Zeit von 1960 bis 1990 vor. Das ästhetische und zeichentechnische Spektrum ist breit. Es handelt sich um Auftragswerke sowie um freie Arbeiten von 35 „Modegestaltern“ – wie die Designerinnen und Designer in der DDR genannt wurden. Die meisten „Gestalter“ waren Frauen. Weiterlesen... Download
Text: © Rose Wagner
Rose Wagner für netzwerk mode textil e.V. (online seit 13.04.2021)
Karl Lagerfeld. Ein Deutscher in Paris.
Kaiser, Alfons: Karl Lagerfeld. Ein Deutscher in Paris. Biographie. München, Verlag C.H. Beck, 2020. 383 S., 58 s/w Abb. ISBN 978-3-406-75630-6.
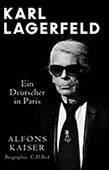
Sechseinhalb Jahrzehnte lang war Karl Lagerfeld (1933-2019) modisch tätig. Seine Produktivität war schwindelerregend. Er war Kreativdirektor mehrerer Modehäuser und arbeitete für eine kaum übersehbare Reihe weiterer Auftraggeber. Selbstironisch kommentierte er: „Mein Name ist Labelfeld“ (S. 152).
Er suchte die große Bühne, schützte jedoch sein Privatleben. Wesentliche Lebensdaten hielt er geheim und erfand fiktive Identitäten. Er wollte alles unter Kontrolle halten, auch sein Bild in der Öffentlichkeit. Mit Brille und Zopf modellierte er sein eigenes Profil zum Markenzeichen. Er gefiel sich in der Pose eines Rockstars, umgeben von einer Entourage junger und schöner Menschen. Dann wieder gab er sich als überkandidelter Dandy mit einer Birmakatze im Arm. Seinen Weltruhm verdankte er nicht zuletzt seinen effektvoll inszenierten Auftritten.
Mit seiner akribisch recherchierten Biographie will Alfons Kaiser zum Kern von Lagerfelds Persönlichkeit vordringen und hinter die Schichten der „Selbstmythisierung“ (S. 13) blicken. Kaiser ist bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für das Ressort „Deutschland und die Welt“ sowie das monatliche Stil-Magazin verantwortlich und kennt sich in der Modeszene aus. Mit Lagerfeld war er lange bekannt.
Das Besondere an Kaisers Biographie ist der Bezug auf das „Deutsche“ an Lagerfeld: seine Herkunft und vor allem sein Arbeitsethos und seine rigorose Disziplin. Die Wurzeln dieser Wesensmerkmale sieht Kaiser im Familienhintergrund, einer Mischung aus hanseatischem Kaufmannsgeist und preußischem Beamtentum. Im „Dritten Reich“ waren die Eltern Lagerfelds in der NSDAP. Weiterlesen... Download
Text: © Rose Wagner
Rose Wagner für netzwerk mode textil e.V. (online seit 26.02.2021)
The Rose in Fashion: Ravishing
De la Haye, Amy u.a.: The Rose in Fashion: Ravishing. Yale University Press, 2020, 240 S., 228 farb. und 38 s/w Abb. ISBN 978-0-300-250084-0HB.
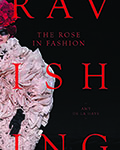
Amy de la Haye und ihre Mitautor*innen Jonathan Faiers, Colleen Hill, Mairi MacKenzie und Geoffrey Munn beleuchten, wie die Kombination von Mode und Rose provoziert, visionäre Modebilder generiert und Gefühle vermittelt und beflügelt. De la Haye ist Professorin für Dress History & Curatorship am London College of Fashion, University of the Arts in London; das Buch erschien anlässlich einer Ausstellung am Museum des Fashion Institute of Technology, New York, die – bedingt durch Corona – auf Anfang 2021 verschoben wurde.
Wie sehr die Rose tatsächlich das Bild der Mode seit dem achtzehnten Jahrhundert mitgeprägt hat, wird an Hand der materialreichen Sammlung mit über 250 Abbildungen deutlich. Hier liegt nicht nur ein Coffee Table Book vor, sondern ein in jeder Hinsicht gehaltvoller Streifzug durch die an Ambivalenzen reiche Ikonographie und Symbolik der Rose bis in das einundzwanzigste Jahrhundert. Amy de la Haye gelingt es auch durch die sinnliche und lei-denschaftliche Herangehensweise an das Thema aufzuzeigen und zu hinterfragen, wie und wodurch die Rose unser Äußeres, unsere Kleidungsvorstellungen, Gefühle und Phantasien beeinflusst hat und vor allem immer noch beeinflusst. So wird Alexander McQueen zum „Fashion´s Rosarion“, dessen Label über seinen frühen Tod hinaus durch seine Vertraute und ehemalige Mitarbeiterin, Sarah Burton, auf Rosen wandert. Weiterlesen... Download
Text: © Ursula Graf
Ursula Graf für netzwerk mode textil e.V. (online seit 06.02.2021)
Körperbilder-Körpersymbole und Bekleidungsvorschriften. Zur Repräsentation von Frauen in Werbung, Medien und Sport
Ingrid Moritz, Birgit Sauer, Asiye Sel: Körperbilder-Körpersymbole und Bekleidungsvorschriften. Zur Repräsentation von Frauen in Werbung, Medien und Sport. Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes ÖGB, Wien 2020, 240 S.. ISBN: 9783990463802
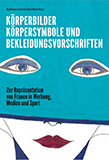
„Vor allem Indientücher, um Hals, Stirn und Kopf gebunden, galten als Symbol der Befreiung vom kleinbürgerlichen Mief der 1950er-Jahre, ebenso waren sie ein Signal der Öffnung hin zu anderen Kulturen. Das Kopftuch wurde damals [in den 1960er und 1970er Jahren, M.K.] frei von jeglicher religiösen und politischen Bedeutung eingesetzt, frech, witzig, theatralisch und pragmatisch.“ (S. 15) Was, so kann man sich fragen, ist passiert, dass mit dem neuen Jahrtausend dieses modische Accessoire zu einem Symbol transformiert wurde, welches die Bevölkerung eines Staates dermaßen zu spalten vermag, dass sich politisch Agierende dazu veranlasst sehen, Kopftuchverbote zum Schutze von Mädchen im Volkschulalter zu erlassen?
Das von Birgit Sauer, Asiye Sel und Ingrid Moritz in Wien im Jahr 2020 im ÖGB-Verlag herausgegebene Buch „Körperbilder, Körpersymbole und Bekleidungsvorschriften“ stellt sich mit dreizehn Artikeln dieser gesellschaftspolitischen Anfrage. Anlass zu dem Sammelband gab eine Tagung im Jahr 2018 in der Arbeiterkammer in Wien zur politischen Instrumentalisierung des Kopftuches. Der Sammelband erweitert diese Debatte und bettet das nunmehr als muslimisch definierte Kleidungsstück ein in einen Diskurs um Körperbilder, Körpersymbole und Bekleidungsvorschriften (...). Weiterlesen... >
Text: © Monika Keller
Monika Keller für Blog Textile Anschläge (online seit 13.12.2020)
Mozarts Modewelten
Breil, Michaela; Pietsch Johannes (Hg.): Mozarts Modewelten. Beiträge zur Wahrnehmungs- und Kleidungsgeschichte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Ausst. Kat. Staatliches Textil- und Industriemuseum Augsburg (tim). Augsburg 2020. 202 S., 124 farb. Abb., ISBN 978-3-00-063396-6

Dieser sehr informative Katalog thematisiert kenntnisreich die alltagskulturellen Bekleidungspraktiken rund um die Künstlerfamilie Mozart in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Als Quellengrundlage dienen bieten die zahlreich überlieferten Briefe der Familie Mozart, in denen vor allem Leopold Mozart feinsinnig ihre jeweiligen Lebensumstände, insbesondere auch die vestimentären Praktiken, beschreibt. Konzertreisen führten die Familie durch halb Europa. Karl Borromäus Murr legt dar, wie komplex die Verflechtung zwischen den Motiven für das außerordentlich aufwendige Reisen einerseits und die Beweggründe für das Schreiben als aufwendiges Kommunikationsmittel andererseits waren, wobei es das eine ohne das andere nicht gegeben hätte. Reisen dient der Überwindung der Fremdheit und der Relativierung der eigenen Position durch die Vernunft, einer aufklärerischen Idee, die aus den Briefen Leopold Mozarts deutlich hervortritt, auch wenn noch die engen Bindungen an die (katholische) Religion, die Tradition und vor allem auch an den herrschaftlichen Machtanspruch der Höfe deutlich zu spüren sind. Weiterlesen... Download
Text: © Dorit Köhler
Dorit Köhler für netzwerk mode textil e. V. (online seit 05.10.2020)
The Secret Life of Tartan – How a Cloth Shaped a Nation
Rae, Vixy: The Secret Life of Tartan – How a Cloth Shaped a Nation. Black & White Publishing, 2019, Edinburgh, 304 S., engl., zahlr. meist farb. Abb., ISBN 978-178530-259-6.
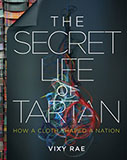
Der schottische Tartan ist mehr als nur ein markant karierter Wollstoff, er ist ein nationales Symbol. Ein Gespinst aus Mythen und Idealisierungen umhüllt ihn. Vixy Ray hat sich seine Entwirrung zum Ziel gesetzt. Ihre Hauptthesen lauten: Im Tartan spiegelt sich die Geschichte Schottlands wider. Er ist identitätsstiftend und schweißt die Nation zusammen. Schottentum ohne Tartan ist undenkbar. Sie zeichnet die Entwicklung des Tartan zu der Nationaltracht nach, die heute weltweit als Ausdruck schottischen Selbstbewusstseins interpretiert wird. In einer Tour d'Horizon verfolgt sie den Niederschlag des Schottenkaros in Malerei, Literatur, Populärkultur und Mode. Sie beschreibt Handelnde und Netzwerke der Tartan-Industrie und porträtiert Nachwuchs-Design-Talente. Die neunzehn Kapitel des Buches tragen als Untertitel jeweils den Namen eines Tartan. Siebzehn Interviews bringen Facettenreichtum in den Text. Die Begriffe Tartan, Kilt, Plaid und Nationaltracht werden weitgehend synonym verwendet. Weiterlesen... Download
Text: © Rose Wagner
Rose Wagner für netzwerk mode textil e.V. (online seit 22.08.2020)