Fashion Metropolis Berlin 1836-1939: The Story of the Rise and Destruction of the Jewish Fashion Industry
Westphal, Uwe: Fashion Metropolis Berlin 1836-1939: The Story of the Rise and Destruction of the Jewish Fashion Industry. Leipzig: Seemann Henschel, 2019.
ISBN 978-3894878061

Old mistakes newly laid out – after thirty years, the journalist Uwe Westphal has reissued his book Berliner Konfektion und Mode 1836-1939: Die Zerstörung einer Tradition (Berlin Confection and Fashion 1836-1939: The Destruction of a Tradition), which first appeared in 1986 as one of the first publications on “Aryanization” in the Berlin textile industry, under a new title and with another publishing house. The history of the Berlin ready-made clothing industry remains an important topic that needs to be engaged with today, and to which various scholars and researchers have been devoting themselves for years. It is regrettable that Westphal, after all these years, does not introduce any new findings into his research, only slightly reformulates the text, republishes incorrect information without checking it, ignores the current state of research, and does not cross-check and critically question the eyewitness interviews he often uses.
In his foreword Westphal says that for decades there has been no memory in Berlin and Germany of “the great style icons of fashion that made history,” namely “the Jewish designers.” In Berlin, “the city of crime,” one knows “almost nothing about it,” and his book represents “maybe one last chance to remember” (pp. 10-11). But he does not use this opportunity. Continue reading... Download
Text: © Gesa Kessemeier and Christine Waidenschlager
Gesa Kessemeier and Christine Waidenschlager for netzwerk mode textil e.V. (in German online since 16 May 2019)
Zur Hölle mit der Mode.
Hawes, Elizabeth: Zur Hölle mit der Mode. Übersetzung Constanze Derham, Berlin, Kooperation Schnatmeyer & Derham, 2019. 416 S. 24 Abb. ISBN 9783948255008

Elizabeth Hawes (1903-1971) war in den 1930er-Jahren der Paradiesvogel der amerikanischen Mo-deszene. Sie stand politisch links, führte ein Bohème-Leben und war eine der ersten Designerinnen, die ein eigenes Label gründeten und in New York einen Haute-Couture-Salon betrieben. Für betuchte Kundinnen schneiderte sie lässig elegante Kleider. Ihre Entwürfe trugen Namen wie „Fünfjahrplan“ oder „New Deal“. An Hosen für Frauen fand sie „nichts verkehrt“ – sie selbst trug zu ihrer Hochzeit 1937 Jeans – genauso wenig wie an Röcken für Männer. Ihr Credo lautete: Kleidung muss bequem sein. Parallel zu ihrer Maßschneiderei arbeitete sie für Kaufhäuser und preisgünstige Bekleidungshersteller. Hawes war immer für Überraschungen gut. Auf eigene Faust und ohne eingeladen zu sein, reiste sie 1931 nach Paris, um dort ihre Kollektion zu präsentieren. Im Jahr 1935 führte sie – dieses Mal auf Einladung – ihre Modelle in Moskau vor. Das schlug hohe Wellen, war die UdSSR doch erst Ende 1933 von den USA anerkannt worden. Weiterlesen... Download
Text: © Rose Wagner
Rose Wagner für netzwerk mode textil e.V. (online seit 14.12.2019)
Falten-Muster. Texturen von Bildlichkeit
Kapustka, Mateusz/Kirves, Martin/Sundberg, Martin (Hg.), Falten-Muster. Texturen von Bildlichkeit, Textile Studies 9, Emsdetten/Berlin: edition imorde 2018, 174 S., 70 überwiegend farb. Abb., ISBN 978-3-942810-39-5, Texte vorwiegend deutsch, ein Beitrag englisch.

Der aus einer zweitägigen Tagung an der Universität Basel im Jahr 2013 hervorgegangene neunte Band der Zürcher Buchreihe Textile Studies widmet sich unter dem Stichwort Falten-Muster der möglichen Bedeutungs-Überlagerung von Falte und Muster im kunsttheoretischen Diskurs. Der Sammelband mit zehn Beiträgen von Wissenschaftler*innen mit vorwiegend kunsthistorischem Hintergrund beinhaltet auch Artikel mit Bezügen zu eher unbekannten wissenschaftlichen Disziplinen. Die Komparatistin Sabine Mainberger beispielsweise untersucht die Verbindung von Falte und Muster am Beispiel des russisch-amerikanischen Schriftstellers Vladimir Nabokov, der sich neben der Verslehre auch mit den Musterungen der Schmetterlingsflügel beschäftigt hat. Antje von Graevenitz wiederum entwickelt ihre „Faltologie“ (81) anhand einer Kuriosität der Niederlande, dem Kwabornament des 17. Jahrhunderts. Weiterlesen... Download
Text: © Monika Keller
Monika Keller für netzwerk mode textil e.V. (online seit 27. Juni 2019)
Brennender Stoff. Deutsche Mode jüdischer Konfektionäre vom Hausvogteiplatz
Hahn, Kristin & Jacobeit, Sigrid (Hg.): Brennender Stoff. Deutsche Mode jüdischer Konfektionäre vom Hausvogteiplatz. Berlin, Leipzig, Hentrich & Hentrich Verlag, 2018. 152 S., 88 Abb., ISBN 978-3-95565-275-3
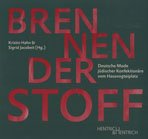
Zweimal jährlich wird anlässlich der seit 2007 stattfindenden Berliner Modewoche in den Medien diskutiert, ob Berlin eine Modestadt ist. Auch wenn sich über das Ergebnis einer solchen Diskussion streiten lässt, muss festgestellt werden, dass bei der Betrachtung die Geschichte, die die Stadt gerade auf dem textilen Sektor vorzuweisen hat, außen vorgelassen wird. Mode wird in Deutschland vielfach als Oberflächenphänomen verstanden, deren kulturelles Kapital – anders als in Frankreich, im Besonderen in Paris – verkannt wird. Dem möchte die Publikation „Brennender Stoff. Deutsche Mode jüdischer Konfektionäre vom Hausvogteiplatz" entgegenwirken. Sie ist Teil des Ergebnisses eines zweisemestrigen Studienprojektes am Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität Berlin. Zunächst skizzieren die beiden Herausgeberinnen, Kristin Hahn und Sigrid Jacobeit, Ziel und Umsetzung des Projektes, das an die Bedeutung des Hausvogteiplatzes und die Modegeschichte Berlins mit ihren jüdischen Wurzeln erinnern will. Weiterlesen... Download
Text: © Marie Helbing
Marie Helbing für netzwerk mode textil e.V. (online seit 19. März 2019)
Modegruppen und Textilzirkel in der DDR. Die Sammlung im MEK
Wassermann, Sarah: Modegruppen und Textilzirkel in der DDR. Die Sammlung im MEK. Begleitband zum Forschungsprojekt „Tiefenerschließung der DDR-Textilkunst-Sammlung“, Schriftenband Museum Europäischer Kulturen, Band 21, Husum, Verlag der Kunst Dresden Ingwert Paulsen jr., 2017. 109 S., 100 meist farb. Abb. ISBN 978-3-86530-239-7.

Ausgangspunkt des Bandes bilden Forschungen zu den rund 180 Textilobjekten „künstlerischen Volksschaffens“, die nach dem Zusammenbruch der DDR dem Bestand des MEK (Museum Europäischer Kulturen) Berlin eingegliedert wurden. Diese vorwiegend von Laien hergestellten Textilobjekte und Kleidungsstücke stammen aus den im Rahmen sozialistischer Kulturpolitik gegründeten Textilzirkeln und Modegruppen, deren Ziel es war, kulturpolitische Freizeitgestaltung zu betreiben, ideologisch im Sinne einer ‘dem Volk zugehörigen Kunst‘.
Inhaltlich nähert sich die Verfasserin in einem ersten Abschnitt den politischen und ideologischen Hintergründen dieser in der gesamten DDR etablierten Textilzirkel an. Es wird dargelegt, wie mit Hilfe des „künstlerischen Volksschaffens“ (S. 10) ein staatlich forciertes Kunstverständnis aufgebaut wird, das zum einen das kulturelle Niveau der Bevölkerung im Sinne politisch-ideologischer Persönlichkeitsbildung heben und zum anderen eine eigene, identitätsstiftende Nationalkultur schaffen soll. Die Umformung bäuerlicher Traditionen zu einer Arbeiter-Kultur gelang jedoch nur begrenzt, da zum einen eine Abgrenzung gegenüber nationalsozialistischer Blut-und-Boden-Ideologie erfolgen musste, andererseits wegen dem kreativen Arbeiten innewohnenden Freiheitsbedürfnis. Weiterlesen... Download
Text: © Monika Keller
Monika Keller für netzwerk mode textil e.V. (online seit 08. Februar 2018)
Meisterstücke zwischen Mode und Tracht. Caraco- und Spenzergewand
Szeibert, Rita: Meisterstücke zwischen Mode und Tracht. Caraco- und Spenzergewand. München, Hirmer Verlag, 2017. 164 S., 197 Abb. ISBN 978-3-7774-2929-8.

In sehr geschmackvoller Gestaltung stellt die Monographie eine der interessantesten Objektgruppen innerhalb der Kleidungsgeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts vor: die Schoßjacken und Spenzer der Frauen. Rita Szeibert, als Autorin bereits bekannt durch „Die Münchnerinnen und ihre Tracht“ (1997), tritt nun mit Fachkenntnis und Begeisterung den Beweis an, dass es sich dabei um „zentrale Elemente der bürgerlich-städtischen Tracht“ handelt, „als bürgerliche Eigenleistung zu werten“ (S. 8), kreiert aus dem jeweiligen modischen Angebot und getragen mit dem Standesbewusstsein des wohlhabenden Bürgertums.
Mit qualitätvollen Fotos, Zeichnungen und detaillierten Beschreibungen der Materialien, Schnitte und Auszier stellt Szeibert 37 Oberteile vor, allein 17 aus dem Bayerischen Nationalmuseum, die übrigen vorwiegend aus oberbayerischen Sammlungen. Unerwähnt bleibt leider, ob in den Beständen der angegebenen Museen systematisch recherchiert oder gezielt nur die prächtigsten Exemplare ausgewählt wurden. Auch der regionale Rahmen ist nicht klar definiert. Nur in sieben Fällen konnte Szeibert auf eine Herkunftsangabe zurückgreifen. Weiterlesen... Download
Text: © Birgit Jauernig
Birgit Jauernig für netzwerk mode textil e.V. (online seit 08. Februar 2018)
Mehr Wind! Ein Streifzug durch die Welt der Fächer
Merkle, Hans: Mehr Wind! Ein Streifzug durch die Welt der Fächer. München, Hirmer Verlag, 200 S., durchgehend vierfarbig, ISBN 978-3-7774-2828-4

In den letzten 20 Jahren lässt sich im deutschsprachigen Raum ein wachsendes Interesse an kunstvoll gestalteten europäischen und asiatischen Fächern feststellen, das sich in zahlreichen Publikationen und jüngst in der Veranstaltung einer ausschließlich dem Fächer ge-widmeten internationalen Tagung an der Universität Zürich („Der Fächer als Bild, Accessoire und gestisches Instrument“, 29.11. bis 1.12.2017) offenbart. Seit der Gründung des einzigen deutschen Fächermuseums in Bielefeld 1996 ist zudem die dort aufbewahrte, umfangreiche Privatsammlung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und in einer Veröffentlichung (2003) dokumentiert. Asiatische wie auch europäische Fächer sind leider nur selten in Ausstellungen zu sehen, gelten sie doch zumeist als begleitende Accessoires, die nur im Rahmen von Modeausstellungen präsentiert werden. So ist es zu begrüßen, dass jetzt erneut eine weitere private Kollektion von Fächern dem Publikum bekannt gemacht wird.
In ansprechendem Querformat gedruckt, das die abgebildeten Fächer in ihrem ausgebreiteten Zustand zeigt, dokumentiert das Buch die private Sammlung Hans Merkles, der zugleich als Autor verantwortlich zeichnet. Neben überwiegend aus Europa stammenden „Miniatur-kunstwerken in Halbrund“ (S. 7) aus dem 17. bis 19. Jahrhundert werden auch 19 außereuropäische Fächer publiziert. Weiterlesen... Download
Text: © Isa Fleischmann-Heck
Isa Fleischmann-Heck für netzwerk mode textil e.V. (online seit 08.02.2018)
Selber machen. Diskurse und Praktiken des „Do it yourself“
Langreiter, Nikola; Löffler, Klara (Hg.): Selber machen. Diskurse und Praktiken des „Do it yourself“. Bielefeld, Transcript, 2017. 352 S., zahlr. s/w Abb.
ISBN 978-3-8376-3350-4

Mach es selbst! – Dieser zeitgeistige Imperativ wird von den Autor*innen der Publikation „Selber machen“ sowohl aus historischer, gesellschaftlicher, emanzipatorischer, marktwirtschaftlicher und ästhetischer Perspektive hinterfragt. Die Themenfelder sind gleichsam heterogen, so reicht das Spektrum sowohl vom Textilen, über Holzverarbeitung zum Programmieren als auch vom Handarbeiten über das Heimwerken zum Maker Movement und Urban Farming. Die Aufsatzsammlung basiert auf den Beiträgen zur Tagung „Do it! Yourself? Fragen zu (Forschungs-)Praktiken des Selbermachens“ (Institut für Europäische Ethnologie, Universität Wien, 2015) und wurde noch um weitere Texte ergänzt.
Nach einer kurzen Einführung der Herausgeberinnen folgen zwei historische Inblicknahmen: Reinhild Kreis beschreibt das Pädagogische eines sinnstiftenden Konzepts effektiver Zeitnutzung anhand produktiver Techniken des Bastelns, und Jonathan Voges zeigt anhand zahlreicher medialer Beispiele auf, wie das Heimwerken in den 1960er-Jahren zur moralisierenden Disziplinierungsstrategie avancierte. Beide Autor*innen machen einführend deutlich, dass eine kritische Betrachtung des Phänomens immer auch seine disziplinierenden und instrumentalisierenden Aspekte mitdenken sollte. Weiterlesen... Download
Text: © Dagmar Venohr
Dagmar Venohr für netzwerk mode textil e.V. (online seit 15.Dezember 2017)
Mode Design Theorie
Schmelzer-Ziringer, Barbara: Mode Design Theorie. Wien u. a., Böhlau Verlag, 2015, 288 S., 21 s/w-Abb. ISBN: 978-3-8252-4403-3

„Der Leib – und alles, was den Leib berührt – ist der Ort der Herkunft: am Leib findet man das Stigma der vergangenen Ereignisse, aus ihm erwachsen auch die Begierden, die Ohnmachten und die Irrtümer; am Leib finden die Ereignisse ihre Einheit und ihren Ausdruck, in ihm entzweien sie sich aber auch und tragen ihre unaufhörlichen Konflikte aus.“ (S. 5)
Dieses Zitat aus der Arbeit Michel Foucaults – „Nietzsche, die Genealogie, die Historie“–, mit dem Barbara Schmelzer-Ziringer ihr Buch „Mode Design Theorie“ einleitet, ist in vieler Hinsicht für das Vorhaben der Autorin programmatisch. Schmelzer-Ziringer bekennt sich damit zu einem, dem Poststrukturalismus entlehnten, diskursanalytischen Ansatz. Im vorliegenden Buch wird dem folgend keine Historie der Mode erzählt, sondern die Systeme der Mode, ihre Akteure, Strukturen und Themen, als änderbares Gefüge dargestellt. Sollte die Wahrheit, wie Michel Foucault meinte, ein historischer Irrtum sein, dann wäre die Suche nach ihr es ebenso. Anstelle der Suche nach einer Wahrheit aber, entsteht aus einer Untersuchung der Strukturen der Macht ein Wissen, über das es zu verhandeln gilt, und innerhalb dessen Meinungsdivergenzen vorkommen und ausgetragen werden. Dieser Denkschule folgend, ist das Ziel des Buches eine Problematisierung der strukturellen Machtverhältnisse, die Mode und Design einerseits prägen, und durch welche, diese wiederum prägenden Einfluss auf soziale, ökonomische, geschlechtliche, kulturelle und politische Bedingungen nehmen.
Weiterlesen... Download
Text: © Alice Goudsmit
Alice Goudsmit für netzwerk mode textil e. V. (online: 27. 11.2017)
Verstrickungen. Kulturanthropologische Perspektiven auf Stricken und Handarbeit
Arantes, Lydia Maria: Verstrickungen. Kulturanthropologische Perspektiven auf Stricken und Handarbeit. Berlin, Panama-Verlag 2017, 350 S., 24 farbige Abb., 3 s/w-Abb., ISBN: 978-3-938714-55-3

Ein großer Teil dieser anthropologischen Studie „Verstrickungen“ beschäftigt sich mit dem Fach der Kulturanthropologie selbst, seinen Richtungen, seiner in den letzten Jahrzehnten statt gefundenen Neuorientierung sowie der damit einhergehenden Neudefinierung und Umbenennung des Faches aus dem Blickwinkel einer Wissenschaftlerin und Strickerin.
Ihr anfängliches Dilemma war es, so die Autorin, selbst Strickerin zu sein. Dies baute sie jedoch zu ihrer Stärke aus. Zur Auflösung des Dilemmas nutzt Arantes neben den im Fach gängigen Methoden, zusätzlich Strategien aus der Psychologie. Damit eröffnete sie das Feld auch für pädagogische Blickweisen, die sie gern tiefgehender bearbeitet sehen möchte, sowie für therapeutische Ebenen des Themas. Etwa indem die Autorin die These, dass Handwerken, hier Stricken, die Kluft zwischen Innen- und Außenwelt zu überbrücken vermag, vertieft oder Bezug nimmt auf das sogenannte Haut-Ich (nach D. Anzieu 1929-1999). Gemeint ist damit, die auf der Haut zu spürende Berührung der Wolle beim Arbeiten und das gleichzeitige Berührt werden vom entstehenden Produkt. Die Problematik, das Thema Stricken und Stricker*innen überhaupt wissenschaftlich anerkannt zu bekommen (in der Forschung liegt meist der fertige Gegenstand im Fokus) löste Arantes durch klare Anwendung und Erläuterung wissenschaftlicher Methoden wie der Ethnopsychologie, der anthropologie des techniques nach M. Mauss (1872-1950) und A. Leroi-Gourhan (1911-1986) und den material culture studies, sowie mit der Beschäftigung mit der Writing Cultur-Debatte der 1980er Jahre.
Weiterlesen... Download
Text: © Evelyn Schweynoch
Evelyn Schweynoch für netzwerk mode textil e.V. (online seit 12.11.2017)